Paint it black
in Not geratene Kulturtechnik
„Bis man mich erschießt, werde ich darauf beharren, dass Kunst,
sobald sie mit Politik in Berührung gebracht wird, unvermeidlich
auf das Niveau beliebigen ideologischen Plunders herabsinkt.“
Vladimir Nabokov, Frühling in Fialta [1]
Liebe Leserin, lieber Leser
In dem Text zu Blackfacing finden sich keine Gender-Sterne, weil ich deutsch schreibe und nicht ideologisch. Das habe ich die letzten 45 Jahre so gehalten und werde es für eine Handvoll Dollar nicht ändern. Was den Gebrauch von Wörtern wie „Neger“ oder „negro“ betrifft, habe ich zu viele von ihnen kennengelernt, die darauf stolz waren, ein selbiger zu sein, dass ich ihr Andenken nicht für eine Handvoll Schneeflocken verrate. Und bitte schreiben Sie mir nicht. Ich weiß, dass ich mehr oder weniger häufig ein Rassist bin, aber das wird man mir nicht mehr abgewöhnen können. Den Kerl nehme ich mit ins Grab. Versprochen.
Karl Bruckmaier
„I want to be black / I want to be like Martin Luther King / and get myself shot in spring / …I don’t want to be a fucked up, middle class College student anymore / …Yeah, yeah I want to be black.“ [3]
Darum lasst uns alle zu angekokeltem Kork greifen, zu fettrotem Lippenstift, zur Kraushaarperücke und einer Platte von Sly Stone: „Thank You Falettinme Be Mice Elf Agin“. [4] Ist ja auch nicht klar, ob das Zebra nun schwarze Streifen hat oder weiße. Eben. Treten wir ein in die Internationale der Rassisten, denn vor dem Vorurteil sind wir alle gleich, der kanadische Premier als Aladin, der deutsche Kabarettist als afrikanischer Spross von Franz Josef Strauß, Othello auf der Bühne, ein eitler Literaturkritiker im TV, die Mohrenapotheke wie der Negerkuss, all die N-Wort-Flüsterer, der „Zwarte Piet“ beim vorweihnachtlichen Straßenkarneval sowieso und eben Lou Reeds negrophiler Redneck-Lümmel, der mit seiner Penislänge nicht ganz zufrieden ist: „Yeah, yeah I want to be black… / and have a big prick, too!“ [5] Dabei war von Blackfacing und Minstrel Show noch gar nicht die Rede – zwei Dinge, von denen das eine Ding nicht ohne das andere Dingaling zu denken ist!
Da zurzeit Gewissheiten mehr zählen als Gewusstes, ein Gewissen mehr wert ist als Wissen, nimmt es nicht wunder, dass über Blackfacing, das Anschminken einer anderen Hautfarbe zu bestimmten, noch näher zu ergründenden Zwecken, das Urteil gefällt ist, bevor auch nur ein einziger Zeuge gehört wurde. Schön, dass wenigstens das deutsche Wikipedia zwar wankt, aber nicht fällt, wenn es um Blackfacing geht. Doch schon der Deutschlandfunk belehrt uns, „dass sich (dabei) ein weißer Mensch das Gesicht mit Farbe bemalt, um auf der Bühne eine Figur mit dunkler Haut darzustellen – und sie dadurch abwertet.“ [6] Und im Spiegel können die Entscheidungsträger in den Medien und der Politik halbamtlich nachlesen, Blackfacing sei „mittlerweile zu Recht verpönt“, [7] denn, so noch einmal der Deutschlandfunk, es sei „die rassistische Fratze hinter der Sprachmaske“, [8] die uns da anbleckt. Darauf lässt der Deutsche Kulturrat, wer immer das ist, kommentieren, dass „wir uns zugunsten einer diskriminierungsfreien Gesellschaft davon befreien müssen“. [9] Caspar blickt verblüfft zu Melchior und Balthasar, und weiß für einen Moment gar nicht mehr, wer von den beiden nun schwarz im Gesicht sein sollte. Zur Sicherheit lässt die Katholische Aktion Österreich durch ihren Vizepräsidenten verlauten, die hiesigen Sternsinger stünden für „Antirassismus schlechthin“. [10] Das Morgenland atmet auf und das Abendland tief durch.
Die lustige Suada könnte so weiter gehen, bis die erbetenen 20.000 Zeichen für diesen Text erreicht sind. Doch habe ich in meinem Buch „The Story of Pop“ [11] zu skizzieren versucht, dass Blackfacing und Minstrel Show herausragende US-amerikanische Kulturleistungen darstellen, ohne die unsere moderne, westliche Gesellschaft überhaupt nicht vorstellbar wäre. Erst die unbekümmerte, wilde, grundsätzlich widersprüchliche, zuzeiten tatsächlich rassistische, [12] dann aber doch zutiefst emanzipatorische Hybridbildung hat uns zu den Menschen gemacht, die wir sind oder sein wollen: irgendwie black halt. Oder kennen Sie jemanden, der lieber ein Aborigine oder Han-Chinese sein möchte? Und dies hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern alles mit kultureller Prägung.
Von diesem Erkenntnisstand aus ist es unmöglich, die Verdammung von Minstrelsy und Blackfacing unkommentiert zu lassen. Im Folgenden also der Versuch einer Ehrenrettung für diese Ur-Identitätssuche des Pop, denn erstaunlicherweise scheint in der Fachwelt – entgegen der herrschenden Stimmungslage – quer durch die Jahrzehnte und ungeachtet der Herkunft oder der Hautfarbe der Autoren der Konsens zu herrschen, dass Blackfacing den Menschen mehr genutzt hat als geschadet. Sein Wert für die Gesamtgesellschaft scheint unumstritten. Erst seit in den letzten Jahren die persönliche Befindlichkeit als Kategorie in den Veröffentlichungen eine zunehmende Rolle spielt, wird Blackfacing vornehmlich negativ dargestellt, aber das aufgrund der Faktenlage selbst dort eher halbherzig. Also, yeah, yeah, I want to be black…
Die ersten Minstrel Shows, also Auftritte teils schwarz geschminkter, jedoch weißer Schauspieler und Musiker in den Nordstaaten der USA, die vermeintlich afroamerikanische Musik und Sketche zum Vortrag bringen, werden zeitlich irgendwann in den Jahren zwischen 1820 und 1840 angesiedelt. [13] Natürlich wurde die Musik der schwarzen Sklaven auch schon vorher von Weißen wahrgenommen. Zumindest Schilderungen schwarzer Musik in den Vereinigten Staaten, Kuba oder Mexiko existierten, spielte diese doch bereits auf den Transporten der schwarzen Sklaven in die Neue Welt eine lebensrettende und den weißen Peinigern auffallende Rolle. [14] Diese Texte erzählen von der Fähigkeit vieler Schwarzer, aus dem Stegreif Texte und Melodien zu schaffen, [15] erzählen von orgiastischen Tanzveranstaltungen auf dem Congo Square in New Orleans, „where they rock the city with their Congo dances.“ [16] Rock the city! Geht’s noch? Noch weiter südlich hört dann ein Alexander Humboldt erstmals schwarze Musik: „Es war Sonntagnacht, und die Sklaven tanzten zur rauschenden, eintönigen Musik einer Gitarre.“ [17]
Es ist dann aber ein deutscher Oboist, der wohl als erster Weißer afroamerikanischer Musik so viel abgewinnt, dass er sich ein Banjo besorgt, einige Stücke zu spielen lernt und das Gelernte in eine Eigenkomposition transformiert: Johann Christian Gottlieb Graupner veröffentlichte 1799 nach einer Konzertreise in den US-Süden im heimatlichen Boston die Noten zu „The Gay Negro Boy“. [18] Und als wären wir jetzt endgültig in einem Karl May-Roman gelandet, war es ein weiterer Deutscher, Anton Philip Heinrich, der 1820 ein Liederbuch veröffentlichte, das „The Western Minstrel“ hieß. [19]
Doch bevor wir uns endgültig den Shows dieser Minstrels zuwenden, muss die Frage gestellt werden, was Humboldt, Graupner, Heinrich und die anderen, denen die frühe Musik Afroamerikas überhaupt aufgefallen ist, da gehört haben: In der Karibik, in Südamerika sicherlich halbwegs authentische Musik aus Afrika, trommelgetrieben, abhängig davon, welche Ethnie sich auf den Schiffen, den Sklavenmärkten, den Plantagen schlussendlich durchzusetzen wusste – nur weil die Haut schwarz war, waren sich die entführten Menschen ja nicht grün. Todfeinde lagen da nebeneinander in Ketten. Fremde Sprachen. Fremde Götter. Völlig uneinheitliche kulturelle Hintergründe. Unser westeuropäischer Blick auf „die Sklaven“ jener Tage konstruiert eine nie existiert habende Homogenität. Doch eins hatten sie alle tatsächlich gemeinsam: die Trommel.
Auf dem Gebiet der heutigen USA hingegen, vom Sonderfall New Orleans abgesehen, [20] war die Trommel zum Schweigen gebracht von den britisch-stämmigen Kolonialherren, die das Instrument richtigerweise als Waffe klassifizierten. Zudem stammten die meisten für Nordamerika bestimmten Sklaven aus Westafrika, geraubt vielleicht bis hinein in die Sahelzone, eventuell mit arabischer Musik vertraut, andere Skalen hörend und singend, Muslime gar. Deren der Trommel beraubte Musik verband sich schnell mit den Kirchenliedern der frömmelnden Sektierer, an die sie verkauft worden sind, mit dem Zerrbild höfischer Musik aus Europa, die es bis Virginia oder in die Carolinas geschafft hatte, mit den blutrünstigen Balladen von irischen, schottischen, deutschen Zuwanderern, speziell als nach dem Verbot des Sklavenhandels im Jahr 1807 die Verbindung zu „Mutter Afrika“ abgerissen ist und die Zucht von Sklaven den Handel ersetzt hat. W.E.B. Du Bois, Afroamerikas erster großer Denker, suchte dies in Worte zu fassen: „Der Neger (…) ist eine Art siebter Sohn, geboren (…) in diese amerikanische Welt, (…) die ihm kein wahres Selbstbewusstsein zugesteht und in der er sich selbst nur durch die Offenbarung der anderen Welt erkennen kann.“ [21] Die Existenz einer afrikanisch geprägten kulturellen Identität von US-Amerikas Schwarzen war also selbst um 1900 mehr Wunschdenken als Fakt, die Heimat der Vorfahren entrückt, die jetzige Heimat entfremdet: die „erasure of black identity“ begann und endete mit der Fahrt über den Atlantik, der Mittelpassage, nicht mit Blackfacing. [22] Selbst ein Kolonialist reinsten Wassers wie Alexis de Tocqueville bringt dafür bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts insektenforscherhaft-kühles Mitleid auf: „Die Erinnerung an die Sklaverei entehrt die Rasse, und in der Rasse dauert die Erinnerung an die Sklaverei fort.“ [23]
Entfremdung, Erinnerung und Wunschdenken sind die Wurzeln der Minstrel Show, genauso wie sie 100 Jahre später die von Country-Musik und Folk sein werden. Nicht umsonst spricht ein Tennessee Williams davon, dass es keine Erinnerung ohne die passende Musik dazu gibt. [24] Und dieses Triumvirat der gemischten Gefühle übernimmt bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Kommando über die Lebenswelt der im Zuge der ersten Landfluchtwelle in den Städten nach Arbeit suchenden Nachgeborenen der einstigen Einwanderer, Siedler, Sklavenhalter [25] Ergänzt wurde diese emotionale Gemengelage durch den Wunsch, sich kulturell und geschichtlich von Europa und vor allem von Großbritannien abzusetzen. So wie man eigene Helden kreierte – Nat Bumppo, Davy Crockett – so sehnte man sich nach einer eigenständigen Musik und Literatur, die nicht mehr europäischen Vorstellungen folgten, so dass Greil Marcus 2013 in einem Aufsatz über Minstrel Shows guten Gewissens behaupten kann, hier offenbare „sich zum ersten Mal in der Geschichte der USA eine eigenständige, nationale Kunstform, deren Bezugsrahmen jedermann verständlich und zugänglich war“. In dieser „eigenständigen Kunstform“ erträumten sich speziell die Menschen im Norden einen räumlich entrückten Süden mit einem imaginierten Luxus auf den Plantagen, wo scheinbar harmonisch eine Art Adel mit zufriedenen Untertanen lebte, die sich allabendlich nach getaner Arbeit zu harmonischem Austausch von Liedgut trafen. Und der weiche, singende Sprachstil des Südens bis hin zur schwer verständlichen, verschliffenen Sprache der Schwarzen war so sexy für Amerikas Weiße [26] wie Wienerisch oder ungarisches Deutsch für die Operettenbesucher in Berlin.
Paradoxerweise war es ein durchreisender Engländer namens Chris Matthews, der als erster die Transgression wagte und als schwarzgeschminkter Sänger auf amerikanischen Bühnen „Possum Up a Gum Tree“ zum Besten gab – mit umwerfendem Erfolg. In seinem Gefolge, im Jahr 1828, betritt eine Gestalt die Bühne, der Blackfacing und die Minstrel Shows allgemein ihren heute verheerenden Ruf verdanken: Jim Crow, Namensgeber für die rassistische Gesetzgebungs- und Lebenswirklichkeit in den Südstaaten ab etwa 1890. Die Kunstfigur Jim Crow des Sängers T.D. Rice, [27] hinkend, dümmlich, dreist, etablierte sich als Bühnenstandard ebenso wie Zip Coon, [28] erfunden von George Dixon, der einen smarten, gut gekleideten Charakter schuf, kein Sklave, erfolgreich bei den Damen und voller krimineller Energie. Diese Typen bevölkerten isoliert die Bühnen in Schanklokalen und sangen ihre immer gleichen Lieder. 1843 kam es dann zum so genannten „Big Bang of minstrelsy“, als sich vier arbeitslose Blackface-Schauspieler in Brooklyn eine Art Südstaaten-Revue ausdachten und als The Virginia Minstrels dann auch performten. Der Erfolg war umwerfend und im Nu gab es ungezählte Nachahmer, am wichtigsten, weil stilprägend:

Die Christy Minstrels. Ihre Gliederung der Show in drei unterschiedliche Akte und die strikte Aufgabenteilung innerhalb des komischen Personals wurden sofort Standard: Im 1. Akt traten alle Protagonisten gemeinsam auf, angeführt vom „Interlocutor“ (im Zirkus wäre dies der Weißclown oder der Direktor), der „Gentlemen, be seated!“ ruft, worauf Tambo, Bones (das Zirkus-Äquivalent: der dumme August) und beliebig viele andere Interpreten Platz nehmen und reihum entweder zu Banjo und Rassel Lieder singen oder Witze reißen. Waren die dummen Auguste anfangs ärmlich gekleidet, etablierte sich bereits ab 1847 eine Art Fake-Weltläufigkeit, gekennzeichnet durch Zylinderhüte, weiße Handschuhe, Frack oder Kragen. Gleich blieben die Überheblichkeit des weißen Interlocutors und die absichtliche oder zufällige Überlegenheit der beiden schwarz geschminkten Dummköpfe und ihrer Freunde. Der 2. Akt war Einzelnummern vorbehalten, die von Akrobatik bis Tanz alles beinhalten konnten. Blackface war hier eher selten. Dieser 2. Akt gilt als Vorstufe der Vaudeville-Theater, welche die Minstrel Shows zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger ablösten, weil u.a. die irischen oder italienischen Einwanderer mit der Südstaatenromantik der vorherigen Generationen nichts anzufangen wussten. Blackface begann von der Bühne zu verschwinden, wanderte im 20. Jahrhundert ab zu Radio, Film und Fernsehen: Hallo Amos, hallo Andy! Bis es auch dort als veraltet galt und der liberalen weißen und betroffenen schwarzen Werbekundschaft in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung auch nicht mehr zumutbar schien.
Der letzte Akt der Minstrel Show war meist ein kurzes Theaterstück, das sich tagesaktuelle Ereignisse vorknöpfte und lokale Berühmtheiten parodierte, und in einem Umzug aller Teilnehmer endete, dem später als Modetanz so erfolgreichen Cake Walk, hier gleichermaßen Vorbild für die Schlussparade im Zirkus. Denn die Welt von Barnum und Co., von Buffalo Bills Wild West Show und die der Minstrel Shows war von Anfang an eng verknüpft, wobei der Zirkus ehrbar und familientauglich sein sollte (und für alles andere die Side Show kannte), die Minstrel Show aber gesellschaftlich wie politisch durchaus riskant sein durfte – Blackface schützte bis zu einem gewissen Grad seine Protagonisten; die Minstrel Show lebte nicht nur von ihren sentimentalen oder dummdreisten Fake-Sklavenliedern, sondern von der proletarisch-derben Angriffslust auf jegliche Autorität, Ethnie oder Gesellschaftsschicht. Wenn wir Heutigen nur die rußverschmierten Gesichter, die rollenden Augen, die fetten roten Lippen sehen, verstellt uns unsere Empörung den Blick auf das kritische Potential der Maske Blackface für Bühnenkünstler in jenen Tagen. Erst wenn wir analog dazu Bilder von Weißclown und dummem August, von Harlekin und Pierrot, von Stan und Ollie, vom Preußen im Bauerntheater und daneben dem Seppl in Lederhosen, und schließlich von Chuck D und Flavor Flav in Public Enemy sehen, mag das immer auf Fallhöhe und inneren Widerspruch basierende Grundelement einer emanzipatorischen Wirkmächtigkeit im Komödiantischen deutlicher werden. Die Phasen, in denen Minstrel Shows hauptsächlich auf rassistisch motivierten Klamauk setzten – in den späten 1850er Jahren, in denen die Minstrel Shows entweder pro Sklaverei oder gegen Sklaverei zu sein hatten, weil sich der Bürgerkrieg abzuzeichnen begann, ebenso wie um 1895, als die Restauration in den Südstaaten ihren traurigen Höhepunkt erreichte und Songs wie „All Coons Look Alike to Me“ [29] die Hits der Saison waren – sind in der nun zweihundertjährigen Geschichte von Blackfacing auf der Bühne die Ausnahme.
Trotzdem wären die schwarzgesichtigen Minstrels des 19. Jahrhunderts kaum mehr als eine (pop-)kulturelle Fußnote, hätte sich nicht parallel zu den überwiegend weißen Minstrel-Truppen im Norden nach dem amerikanischen Bürgerkrieg – in Einzelfällen auch davor – afroamerikanische Minstrelsy entwickelt, mit grundsätzlich ähnlichem Repertoire, mit demselben szenischen Aufbau – und mit Blackface. Denn wer vom Schema abwich, ging pleite. Schwarzes wie weißes Publikum wusste, was es wollte, und zwar immer dasselbe. Nur ein wenig anders. [30] Wir begegnen hier einer afroamerikanischen Überlebenstechnik, die Zora Neale Hurston, Ethnologin und Schriftsteller-Starlet der Harlem Renaissance, folgendermaßen zusammenfasst: „Ein Neger, der inmitten von Weißen und ihrer Kultur lebt, re-interpretiert alles, was ihm unterkommt, um es sich so zu eigen zu machen.“ [31] In den synkretistischen Religionen der Karibik und Brasiliens kennt man diese Technik als „hiding in plain sight“. Dort werden katholische Heilige zu Voudon-Göttern; hier im Land ohne Trommeln kleiden sich, bewegen sich, tanzen, sprechen und singen Schwarze wie Weiße, die Schwarze nachzuahmen meinen. Die ihrerseits im Cake Walk ihre weiße Herrschaft parodierten. Diese Abwandlung und Wendung eines sozialen wie künstlerischen Konstrukts war den schwarzen Künstlern oft genug bewusst: [32] „Wir imitieren die weißen Blackies!“ Wie Greil Marcus es einem Sly Stone unterstellt, sind hier die schwarzen Protagonisten der Minstrelsy eher daran interessiert „musikalische und rassenbedingte Grenzen zu untergraben, als sie oberflächlich zu überwinden“. [33] Die Stars der schwarzen Minstrel-Szene trieben es sogar so weit, dass sie sich als „The Real Coons“ vermarkteten. [34] Denn „real“ war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein Signum für Moderne. Nachdem man Jahrzehnte über Weiße gelacht hatte, die Schwarze nachahmten, wollte man jetzt die „echte Negerkunst“ erleben. Die Dame von Welt nahm Cake Walk-Stunden [35] und kaufte Beauty Produkte von Josephine Baker. In Wien ging man zu den dort samt Dorf ausgestellten Ashanti in den Prater und las Peter Altenbergs Liebeserklärung an die schwarzen Nymphchen. [36]
Es war zwar nur wenigen afroamerikanischen Protagonisten wie Bert Williams oder Aida Overton Walker ein schließlich sogar internationaler Erfolg mit entsprechenden Einnahmen vergönnt – aber von etwa 1870 an bis weit hinein ins 20. Jahrhundert wurde das Dasein als schwarzer Schauspieler eine erstrebenswerte Karriere und Einnahmequelle für Afroamerikaner und somit von eminenter Wichtigkeit für Menschen, die eben noch reinen Warencharakter hatten. 1880 verzeichnete die US-Steuerbehörde 1.490 „Neger im Bühnengewerbe“, 1910 waren es immerhin 3.088, die mit ihren Shows neben den USA auch Australien, Großbritannien und Kontinentaleuropa bereisten, dazu schwarze Promoter, Veranstalter, Komponisten etc. Mehr als hundert Afroamerikaner sollen im Jahr 1896 Deutschland bespielt haben. Diese stetig anwachsende Präsenz schwarzer Bühnenkünstler in einem westlich-weißen Umfeld weckte ein ebenso stetig zunehmendes Interesse an schwarzer Kultur, was schließlich sogar die hartnäckigsten Kritiker, ja Widersacher der Minstrel Shows umstimmte, nämlich die bürgerlichen Schwarzen in den Großstädten des Nordens, die sich für die ungehobelten, ungebildeten und lauten Verwandten aus dem Süden habituell schämten. Als ein Mark Twain, ein Walt Whitman, ein Abraham Lincoln oder – ganz früh – Charles Dickens ihrer Begeisterung für Blackface und Minstrelsy freien Lauf ließen, zog auch die schwarze Bourgeoisie zurück: „Nun, es mag auch seine guten Seiten haben, wenn dunkelhäutige Menschen vor einem weißen Publikum auftreten und Erfolge feiern.“
In den USA werden oft genug gesellschaftliche Spannungen, die aus Klassengegensätzen und den Besitzverhältnissen resultieren, für Rassismus gehalten. Rory Sutherland, stellvertretender Geschäftsführer der Werbeagentur Ogilvy, sagt im Hinblick auf Black Lives Matter etwas, das auch zu Zeiten der ersten Minstrel Shows gegolten haben mag: „Das Problem mit den Amerikanern ist, dass sie von Klassen keinen Begriff haben, weil sie diese ja leugnen. Sie können die Menschen auch nicht nach ihrer Herkunft unterteilen, weil sie von Geographie keinen Schimmer haben. So bleibt ihnen auf immer und ewig allein die Rasse als Erklärungsmodell.“ [37]
Oder wie mir mein Freund Amiri Baraka immer wieder einzubläuen versucht hat: „Es geht nicht um Rassen, sondern Klassen.“
Aber vielleicht geht es sogar um noch mehr: Blackfacing, die Minstrel Shows, all die Coon Songs und verdrehten Augen und stereotypen Verhaltensweisen, auch die Bereitschaft so vieler weißer wie schwarzer Künstler sich diesen Schuh anzuziehen, mag vielleicht direkt auf den einen Kern verweisen: Kunst, große Kunst spricht uns alle an, egal, welche Hautfarbe, welches Alter, welches Bildungsniveau. Die Kunst der Minstrels, ob schwarz oder weiß, ob plump rassistisch oder raffiniert dialektisch, kann uns zwar nicht vergessen lassen, welche Opfer die Sklaven und ihre Nachfahren bis zum heutigen Tag brachten und bringen, aber sie kann den Blick dafür weiten, dass wir über dasselbe lachen und weinen, dass wir lieben, dass wir bluten, wie es bei Shakespeare heißt. Dass wir uns in allem und jedem so viel ähnlicher sind als die Schlimmsten von uns glauben. Und die Besten manchmal vergessen. In „Bertha, the Sewing Machine Girl“, einem Singspiel aus dem Jahr 1871, später auch verfilmt, klagt die Protagonistin: „Manchmal arbeite ich 18 Stunden am Tag, nur um zu überleben. Es heißt, die Sklaverei sei abgeschafft, aber es gibt unter New Yorker Näherinnen mehr Sklaven als jemals unter den Negern.“ [38] Yeah, yeah I want to be black…
P.S: Spannend des Autors weitgespannte Kulturgeschichte, unverniedlicht einge-
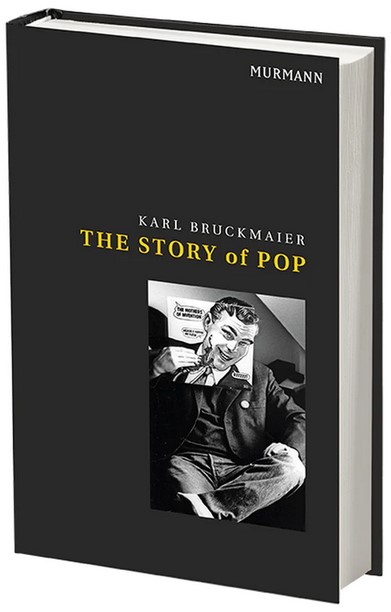
bettet in die Barbareigeschichte der Neuzeit. Den obigen Beitrag verdanken wir dreierlei:
Erstens der einfältigen Cancel Culture des Kremser donaufestivals 2022 (29. April bis 8. Mai), für dessen Reader „Stealing the Stolen“, den es zusätzlich zum Programmheft geben sollte, er verfasst war. Blöde Reaktionen auf Bruckmaiers provokante Vorrede [39] mag die Administration derart verschreckt haben, dass sie ihr bereits ausgedrucktes, erst teilweise verbreitetes 187-Seiten-Büchlein gründlich in die Tonne trat. Abgespeckt keim- und essayfreie fand im übrig gebliebenen Programmheft nichts als die reiche Abfolge der Reihe, wohlgarniert mit zahlreichen Inseraten, eine farbenfrohe Verbreitung. Der Ehrgeiz, kunstvolle Unterhaltung zu bieten, erlaubte zugleich, es wundersam zu vermeiden, das Publikum etwa auf unziemlich freie Gedanken zu bringen.
So mancher hat zwar Wohnkultur
Agri-, FKK- und Esskultur
Was fehlt zum Glücklichsein ihm nur?
correctest gereinigte Normkultur [40]
Zweitens verdanken wir die Kenntnis von diesem Vorgang dem Professor Liessmann, der ihn in einem Interview bedauernd erwähnt hat und dass er den unterdrückten Beitrag gerne gelesen hätte.
Drittens danke ich dem Autor, „Paint it black“ hier darbieten zu dürfen.
P.P.S: Viertens Dank an Gerhard Stöger, dem Musikspezialisten des falter, für zwei freundliche Berichtigungen: 1. Dieses aberwitzige Beispiel von „Cancel Culture“ wurde nicht erst 2023 verbrochen, sondern bereits im Jahr davor;
2. Der Beitrag von Karl Bruckmaier war nicht fürs Programmheft (58 Seiten) vorgesehen, das also unversehrt verwendet wurde. Vielmehr war „Paint it black“ Teil eines begleitenden Readers mit Beiträgen von 10 Autor:innen auf 187 Seiten, und dieses Büchlein hat man eingestampft, nicht das Programmheft. G.O.
[1] Zitiert nach: Vladimir Nabokov, „Frühling in Fialta“, Reinbek 1989
[2] Zitiert nach: Vladimir Nabokov, „Frühling in Fialta“, Reinbek 1989
[3] „I Wanna Be Black“, aus: Lou Reed, „Street Hassle“, Arista Records 1978
[4] Sly and the Family Stone, Single, Epic Records 1969
[5] Lou Reed, aaO.
[6] Barbara Behrendt, „Was ist blackfacing?“, Deutschlandfunk 26.6. 2020
[7] Marc Röhlig, „Dieser Witz ist Rassismus aus Bequemlichkeit“ in Der Spiegel, Hamburg 2021
[8] Joachim Dicks, „Die rassistische Fratze hinter der Sprachmaske“, Deutschlandfunk Kultur 1.2.2015
[9] Tahir Della und Jamie Shearer, „Auch 2020 immer noch rassistisch“, Web-Kommentar vom 10.2.2020
[10] „KAÖ relativiert ‚Blackfacing‘-Vorwurf gegen Sternsinger“, kathpress 5.1.2021
[11] Karl Bruckmaier, „The Story of Pop“, Hamburg 2014 und München 2015
[12] Lustigerweise von beiden Seiten: So musste ein Alan Lomax auf seinen Field Trips manchmal Blackface auflegen, um überhaupt in den afroamerikanischen Gemeinden aktiv werden zu können, und die weißen Mitglieder der gemischtrasssigen Frauen-Big-Band „International Sweethearts of Rhythm“ konnten nur eingeschwärzt in Afroamerikanern vorbehaltene Hotels einchecken. Siehe mein Buch „The Story of Pop“ und den Nachruf auf Helen Jones Woods in der New York Times vom 4.8.2020
[13] Alle Zeitangaben, Namen und Zitate, die nicht extra gekennzeichnet sind, stammen aus Tim Brooks, „The Blackface Minstrel Show in Mass Media“, Jefferson NC 2019, das nur als Kindle Book vorliegt.
[14] Karl Bruckmaier, aaO. S. 32 ff.
[15] ebd. S. 47
[16] ebd. S. 52
[17] ebd. S. 46
[18] ebd. S. 84
[19] ebd. S. 85
[20] ebd. S. 49 ff.
[21] W.E.B. Du Bois, zitiert nach: Hans-Peter Müller, „Das Gefühl ein Problem zu sein“ in Merkur Heft 660, S. 344
[22] Stephanie Dunson, „Black Misrepresentation in Nineteenth-Century Sheet Music Illustration“, in W.F. Brundage (Hrsg.) „Beyond Blackface“, Chapel Hill 2011, S. 45
[23] Alexis de Tocqueville, zitiert nach: Hans-Peter Müller, „Das Gefühl ein Problem zu sein“ in Merkur Heft 660, S. 344
[24] Zitiert nach Geoff Muldaur, „His Last Letter“, Moon River Music 2021, S. 26
[25] Wie dies in weitaus stärkerem Maß ein weiteres Mal nach dem 1. Weltkrieg zu beobachten sein wird, siehe Karl Bruckmaier aaO. S. 153 ff.
[26] En detail nachzulesen in: Zora Neale Hurston, „Characteristics of Negro Expression“, in Nancy Cunard (Hrsg.) „Negro – an Anthology“, New York 2002, S. 24 ff.
[27] Stephanie Dunson, aaO. S. 46
[28] ebd. S. 48
[29] geschrieben von Ernest Hogan, einem Afroamerikaner, der damit eine fast zehn Jahre andauernde Welle von rassistisch-stereotypisierenden „Coon“-Songs auslöste
[30] David Krassner, „The Real Thing“, in W.F. Brundage (Hrsg.) „Beyond Blackface“, Chapel Hill 2011, S. 105
[31] Zora Neale Hurston, „Characteristics of Negro Expression“, in Nancy Cunard (Hrsg.) „Negro – an Anthology“, New York 2002, S. 28
[32] David Krassner, aaO. S. 103 ff.
[33] Greil Marcus, „Sly Stone – Der Mythos von Staggerlee“, in „Mystery Train“, Reinbek 1981, S. 88
[34] David Krassner, aaO. S. 99
[35] ebd. S. 108 ff.
[36] Peter Altenberg, „Ashantee“, Wien 2008
[37] Rory Sutherland, „Language barriers“, in „The Spectator“ 10.4.2021, S. 69
[38] Karl Bruckmaier, aaO. S. 91
[39] „Liebe Leserin, lieber Leser,“ siehe ganz oben



Karl Bruckmaier (* 1956 in Niederbayern) ist ein deutscher Moderator, Kritiker, Autor und Hörspielregisseur.
Inhaltsverzeichnis
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Karl Bruckmaier studierte Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Amerikanische Kulturgeschichte.[1] von 1978 bis 2022 moderierte er regelmäßig die musikjournalistischen Sendungen Club 16, Zündfunk, Nachtmix, Nachtsession im Bayerischen Rundfunk. Von 1985 bis 1987 war er Redakteur des BR-Magazins Zündfunk. Von 1981 bis 2018 schrieb er Pop-Kritiken für die Süddeutsche Zeitung.
Er begann 1989 seine Karriere als Hörspielregisseur. Anfang der 1990er Jahre initiierte er in München die ersten Poetry Slams.
Von 2011 bis 2013 war er Mitglied der Jury „Offene Projektförderung“ der Kulturstiftung des Bundes.
Karl Bruckmaier lebt in München.
Auszeichnungen für Hörspiel- und Hörbuch-Regie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Elfriede Jelinek, Jackie, Hörspielpreis der Kriegsblinden (2004) und Deutscher Hörbuchpreis (2005)
- Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Hörbuch des Jahres (2007) und Deutscher Hörbuchpreis (2008)
- Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, Deutscher Hörbuchpreis (2010)
Hörspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Regisseur und/oder Bearbeiter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Amiri Baraka: When Miles Split (BR 1994)
- Samuel Beckett: Pochade Radiophonique (BR 2005) ISBN 978-3-89940-802-7
- Yvan Goll: Die Eurokokke (BR 2004)
- Elfriede Jelinek: Jackie (BR 2003) ISBN 3-934847-69-2
- Moosbrugger will nichts von sich wissen (BR 2004)
- Bambiland (BR 2006) CD bei Intermedium ISBN 3-934847-56-0
- Neid (BR 2011)
- Licht im Kasten (BR 2017)
- Am Königsweg (BR 2017) CD bei Intermedium
- Romuald Karmakar: Nacht über Gospic (BR)
- Alexander Kluge: Chronik der Gefühle (BR 2009) ISBN 3-88897-588-3
- Die Pranke der Natur (und wir Menschen) – Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte, und das Zeichen von Tschernobyl. (BR 2011) CD bei Kunstmann Verlag ISBN 978-3-88897-762-6
- 30. April 1945: Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. (BR 2015) CD bei Kunstmann Verlag ISBN 978-3-95614-050-1
- Das neue Alphabet (BR 2019)[2]
- Unruhiger Garten der Seele (BR 2022)[3]
- Der Stein in der Tasche (BR 2024)[4]
- Thomas Palzer: Journal intime (BR 1996)
- Carl-Ludwig Reichert: Cut Up Burroughs (BR 1989)
- Amiri Baraka: Real Song (BR 1994) enja CD 8098-2
- Mayo Thompson: Mayo Thompson records nature at the Rauschenberg estate (BR)
- Maria Volk: Blinky, Aufklärungsgespräche (BR 1993)
- Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands (BR/WDR 2007) ISBN 978-3-86717-014-7
- Peter Weiss: Abschied von den Eltern (BR 2013) CD bei Hörverlag/Random House
- Lawrence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (BR 2015) CD bei Hörverlag/Random House
Als Autor und Regisseur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Front (BR/HR 1989)
- Beat (mit Reichert, Kapfer, BR 1989)
- Beat Goes On (mit Carl-Ludwig Reichert, Herbert Kapfer, BR 1989)
- Freak Out (mit Carl-Ludwig Reichert, BR 1989)
- Art (BR 1989)
- Index (BR 1990)
- Der gute Hirte – R.E.M. Love in Vain (BR 1992)
- …is a dangerous number (BR 1994)
- Kimako’s Blues People & The Nuyorican Poets Cafe present:
- - – Krieg der Körper, Krieg der Wörter (BR 1994)
- - – Die Sprache singt (BR 1994)
- - – Die Farbe Schwarz (BR 1994)
- - – Die neuen Stimmen (BR 1994)
- Dann aber wird ein Dichter an ihm verloren gegangen sein – Mutmaßungen über Jakob van Hoddis (BR Hörspiel und Medienkunst 2002)
- Auf dem Dach der Welt – frei nach Alexander Kluge (BR Hörspiel und Medienkunst 2012), CD bei intermedium records
- Klänge (BR Hörspiel und Medienkunst 2015) CD bei Intermedium ISBN 978-3-943157-64-2[5]
- Jedenfalls Krähen (BR 2016)
Bücher
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- I'm only in it for the Zeilenhonorar. Sonnentanz Verlag, Augsburg 1993, ISBN 978-3-926794-18-5.
- Soundcheck. Die 101 wichtigsten Platten der Popgeschichte. C.H. Beck, München 1999, ISBN 3-406-42093-1.
- The Story of Pop. Murmann Verlag, Hamburg 2014, ISBN 978-3-86774-338-9.
- OBI oder das Streben nach Glück (mit dem Fotografen Wilfried Petzi). kursbuch.edition, Sven Murmann Verlagsgesellschaft, Hamburg 2016, ISBN 978-3-946514-16-9.
- Übersetzungen
- Mehrere Bücher als Übersetzer aus dem Amerikanischen, etwa von Jack Womack, Bruce Sterling, John Fahey, John Lennon, Leonard Cohen.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur von und über Karl Bruckmaier im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzbiografie und Rezensionen zu Werken von Karl Bruckmaier bei Perlentaucher
- Le Musterkoffer (Offizielle Website)
- Slam Poetry: Helden der Dichtung, Film von Tilman Urbach, u. a. mit Karl Bruckmaier, BR Fernsehen, 5. November 2015 (Online bis 4. November 2020)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Karl Bruckmaier | LAST RADIO POETS. Abgerufen am 13. Mai 2018 (deutsch).
- ↑ Bayerischer Rundfunk (Hrsg.): "Das neue Alphabet" von Alexander Kluge: Widerständigkeit des Erzählens. 27. November 2019 (br.de [abgerufen am 2. Dezember 2019]).
- ↑ Unruhiger Garten der Seele. Kommentare - Hörspiel Pool. Bayerischer Runfunk, abgerufen am 25. August 2023.
- ↑ "Der Stein in der Tasche" von Alexander Kluge. Bayerischer Rundfunk, 22. April 2024, abgerufen am 30. April 2024.
- ↑ Hörspiel und Medienkunst, Bayerischer Rundfunk: Hörspiel Pool | BR.de. In: www.hoerspielpool.de. 22. April 2016, abgerufen am 23. April 2016 (deutsch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Bruckmaier, Karl |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Pop-Kritiker, Autor und Hörspielregisseur |
| GEBURTSDATUM | 1956 |
| GEBURTSORT | Niederbayern |





